
Autor: Markus OessMit Blinkist hat er Millionen gemacht. Heute setzt sich Sebastian Klein für mehr Steuergerechtigkeit ein und engagiert sich politisch wie gesellschaftlich. Die Kernfrage dieses Interviews lautet: Wie viel Geld ist zu viel – und was macht es mit unserer Gesellschaft? Ein Gespräch mit einem Unternehmer, der 90 Prozent seines Vermögens abgegeben hat, über Ungleichheit, Verantwortung, Steuergerechtigkeit und warum sich selbst ernannte Volksparteien zu populistischen Erzählungen hinreißen lassen.
FASHION TODAY: Herr Klein, Sie wurden sicher schon oft gefragt, wie wichtig Geld für Sie ist. Wie wichtig ist Geld für Glück und Zufriedenheit in der Definition unserer Gesellschaft?
Sebastian Klein: „Ich bin davon überzeugt, dass Geld ein sehr wichtiges Thema ist, wenn wir von Glück und Zufriedenheit in der Gesellschaft sprechen: Auf individueller Ebene ist ein Mangel an Geld ein wesentlicher Faktor. Zu wenig Geld zu haben, macht weniger glücklich, weniger gesund und führt sogar zu einer geringeren Lebenserwartung. Da in Deutschland rund ein Fünftel der Menschen von Armut bedroht ist, ist das ein Riesenthema. Dazu kommt, dass Ungleichheit, also wenn viele sehr arm und wenige sehr reich sind, wie es in Deutschland ja im Moment ist, ein destabilisierender Faktor ist, der eine Gesellschaft untergräbt und die Demokratie zerstört. Wie schnell das gehen kann und wie hässlich es aussehen kann, sehen wir ja gerade in den USA. Deutschland ist bezogen auf die Vermögensungleichheit übrigens nicht sehr weit von den USA entfernt.“
Macht Geld gierig nach noch mehr Geld?
„Meiner persönlichen Erfahrung nach: ja. Wenn man viel Geld hat, ist ein Imperativ, dass man dieses Geld zusammenhält und idealerweise weiter mehrt. Da wir an den Zahlen ja sehen, dass die Reichsten immer reicher werden, bestätigt sich das auch. Wenn Mitgefühl oder Großzügigkeit die Gier und den Geiz überwiegen würden, müsste sich das Problem der extremen Ungleichheit ja von selbst lösen. Schließlich wird niemand gezwungen, sein oder ihr Vermögen immer weiter zu vermehren.“
Was macht Geld mit der Gesellschaft und den gesellschaftlichen Werten?
„Geld an sich ist erst mal neutral. Man kann es ja auch für positive Dinge einsetzen. Oder anders gesagt: Alle großen Probleme, vor denen wir als Gesellschaft, als Welt gerade stehen, lassen sich mit Geld lösen. Wenn dieses Geld aber vor allem zur Profitmaximierung eingesetzt wird, dann vergrößert es die Probleme. Die resultierende Ungleichheit spaltet die Gesellschaft und zerstört die Demokratie.“
Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft. Sorgt Geld trotz wirtschafts- und verteilungspolitischer Leitplanken nicht automatisch für weitere Ungerechtigkeit und Umverteilung von unten nach oben?
„Soziale Marktwirtschaft bedeutet ja eigentlich, dass ein starker, sozialer Staat dafür sorgt, dass die Ungleichheit nicht zu groß wird und dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, sich in der Gesellschaft zu entfalten. So steht es ja in unserem Grundgesetz. Momentan ist das leider in Schieflage geraten, denn der Staat sorgt eben nicht durch ein faires Steuersystem für diese Umverteilung. Es sollte übrigens besser Rückverteilung heißen, denn das Vermögen kommt ja aus der Gesellschaft, Reiche können es zwar horten, aber sie haben es nicht selbst geschaffen.“
Was müsste dagegen passieren?
„Wir müssen unser Steuersystem so korrigieren, dass die Last nicht mehr bei den Menschen liegt, die von Arbeit leben. Heute geben ja Menschen, die von Arbeit leben, rund die Hälfte ihres Einkommens für Steuern und Abgaben ab. Menschen, die sehr reich sind, zahlen sehr viel weniger Steuern und Abgaben auf ihre Einkünfte. Das ist ungerecht und führt natürlich dazu, dass die Gesellschaft immer ungleicher wird. Besonders wichtig ist dabei das Thema Erbschaft: Das meiste Vermögen in Deutschland stammt ja aus Erbschaft und nicht aus eigener Arbeit. Momentan ist es so, dass die wirklich großen Vermögen meist steuerfrei an die nächste Generation übergeben werden. Das heißt, Menschen bekommen, ohne irgendetwas zu leisten, Millionen oder gar Milliarden geschenkt. Und zahlen darauf dann noch nicht mal Steuern. Während Menschen, die für ihr Geld arbeiten müssen oder eine mittlere Summe erben, darauf brav ihre Steuern bezahlen müssen.“
„Soziale Marktwirtschaft bedeutet ja eigentlich, dass ein starker, sozialer Staat dafür sorgt, dass die Ungleichheit nicht zu groß wird und dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, sich in der Gesellschaft zu entfalten.“
Sie haben 90 Prozent Ihres Privatvermögens abgegeben. Wir reden von einer Summe oberhalb von 5 Millionen Euro. Wie sieht das Konstrukt nun aus?
„Mein Vermögen ist zu 90 Prozent in eine gemeinnützige GmbH eingebracht worden. Aus der heraus unterstütze ich mit einem Team Projekte, von denen ich denke, dass sie unsere Gesellschaft besser machen und die Demokratie stärken. Ein Beispiel ist der Media Forward Fund, den wir letztes Jahr gemeinsam mit Stiftungen gegründet haben. Aus dem heraus werden Medienunternehmen gefördert, um damit zur Stärkung der Demokratie beizutragen.“
Wer bestimmt nun, was mit dem Geld passiert, wie sind die Entscheidungswege und welche Ziele haben Sie damit?
„Ich bin in die Entscheidungen involviert, aber ich treffe sie nie allein. Insgesamt ist das Ziel, dazu beizutragen, dass sich unsere Wirtschaft in Richtung Klimaverträglichkeit transformiert. Wir wollen insbesondere dazu beitragen, dass der Finanzmarkt sich transformiert, denn der kontrolliert im Grunde unsere Wirtschaft. Wer Wirtschaft transformieren will, muss den Finanzmarkt transformieren. Wir machen das, indem wir zum Beispiel einen Fonds initiieren, der nur in Unternehmen in Verantwortungseigentum investiert. Diese andere Art, Eigentum zu organisieren, leistet einen wichtigen Beitrag zur Transformation und übrigens auch zur Reduzierung der Ungleichheit. Wenn Verantwortungseigentum die Norm ist, dann muss es keine Milliardäre mehr geben. Aus diesem Grund wehrt sich die Lobby der Milliardärserben auch sehr gegen dieses Konstrukt.“
Persönlichkeiten wie Warren Buffett zum Beispiel oder Bill Gates spenden auch sehr viel Geld. Aber sie bestimmen immer noch, wer das Geld bekommen soll. Ist das nicht auch schon irritierend, dass einzelne Menschen über das Schicksal vieler anderer bestimmen, indem sie sagen, wer unterstützt wird und vor allem, wer nicht, nur weil sie unendlich reich sind?
„Genau, das ist das Problem der Philanthropie: Einzelne Menschen bestimmen, ohne irgendein Mandat, was gut für alle sein soll. Und in Summe sehen wir auch, dass sehr reiche Menschen – relativ gesehen – nicht mehr, sondern weniger spenden als Menschen mit sehr wenig Geld. Insofern sollte man immer kritisch sein, wenn einem ein einzelner großzügiger Spender als Argument vorgehalten wird, das zeigen soll, dass wir nicht über Steuergerechtigkeit reden müssen. Und wenn wir es der Freiwilligkeit überlassen, bleiben am Ende die größten Psychopathen wie Musk und Trump als reichste Menschen übrig. Das halte ich für keine sehr gute Strategie.“
Viel Vermögen wird ja auch vererbt. Haben die Erben moralisch einen Anspruch auf das viele Geld qua Geburt?
„Zunächst mal leben wir ja in einem Land, in dem privates Eigentum geschützt wird. Insofern besteht erst mal ein rechtlicher Anspruch auf ein Erbe. Es gibt aber keinen vernünftigen Grund, warum sehr große Erbschaften nicht besteuert werden sollten wie beispielsweise Arbeitseinkommen. Für Letzteres muss ich eine Leistung erbringen, Ersteres ist völlig leistungsloses Einkommen. Die Aussage, dass dieses Geld ja schon mal versteuert wurde, ist übrigens Quatsch, weil Geld ständig mehrfach besteuert wird, wenn es sich bewegt. Auch die Aussage, wir könnten sehr reiche Erben nicht besteuern, weil dann Arbeitsplätze in Gefahr seien, ist ein reines Märchen. Aber es funktioniert sehr gut, denn es macht den Leuten Angst.“
Die einzige Partei, die ausdrücklich Milliardäre abschaffen will, sind die Linken. Ist Ihnen der Gedanke sympathisch?
„Mir ist erst mal wichtig, dass wir uns im Rahmen unserer demokratischen Grundordnung bewegen. Also alles, was passiert, muss im Rahmen des geltenden Rechts geschehen. Natürlich können wir als Gesellschaft sagen: Es sollte keine Milliardäre geben, und dann ändern wir unsere Steuergesetze entsprechend. Dann werden nicht über Nacht alle Milliardäre enteignet, aber es würde sich mittelfristig was an der Verteilung ändern.“
Vier Familien in Deutschland haben mehr Geld als 40 Millionen Menschen. Warum protestiert die Gesellschaft nicht gegen diese Ungerechtigkeit und es wird stattdessen auf andere gezeigt, die Hilfe benötigen und deswegen erhalten, wie Flüchtende oder Bürgergeldempfänger?
„Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass sich auch selbst ernannte Volksparteien inzwischen nicht mehr zu schade sind, Politik durch Populismus zu ersetzen. Merz und die Union haben uns jahrelang und auch im Wahlkampf getäuscht und ganz gezielt Themen groß gemacht, bei denen sie wussten, dass sie da punkten können. Ich finde das wirklich beschämend und hoffe sehr, dass wir in Zukunft wieder zu einer vernunft- und faktenbasierteren Politik finden werden.“
Häufig wird argumentiert, dass gerade Unternehmer oder Topmanager wegen der großen Verantwortung viel verdienen müssten. Stimmen Sie dem zu?
„Dieses Argument finde ich extrem schwierig. Viele Pflegerinnen, Ärztinnen, Lehrerinnen und so weiter tragen meiner Meinung nach viel mehr Verantwortung als ein Manager. Wieso verdienen die dann keine Millionengehälter? Und wir sehen ja, dass deren Verantwortung meist nur aus großen Worten besteht, wenn sie dann mal für Fehler in die Pflicht genommen werden, dann weisen sie alle Verantwortung von sich. Wir müssen bei vielen Begriffen, mit denen hantiert wird, etwas genauer hinschauen: Was genau meint ein Manager mit Verantwortung? Das betrifft auch andere Konzepte: Selbst ernannte liberale Politiker verwenden auch den Begriff der Freiheit und meinen damit das komplette Gegenteil dessen, was Freiheit im humanistischen Sinne bedeutet.“
Wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass CDU, FDP und AfD ihr Steuermodell so interpretieren, dass der Mittelstand wenig und die Haushalte mit niedrigen Einkommen nur homöopathisch entlastet werden. Die Reichen dagegen werden verhältnismäßig extrem gepampert. Dafür sprechen diese Politiker und natürlich die, die profitieren, wieder gerne von Leistungsgerechtigkeit, Deindustrialisierung und Kapitalflucht. Warum verstehen viele Menschen nicht, was da passiert, wenn wir auf die Wahlen schauen?
„Mein Eindruck ist, dass leider oft die Argumente am besten ziehen, die sich in einem einfachen Satz sagen lassen und die auf den ersten Blick plausibel klingen. Steuerentlastung klingt toll, und wenn der Politiker dann bewusst verschweigt, dass sich die Verteilung für 90 Prozent der Menschen verschlechtern wird, dann werden diese Menschen über ihre eigentlichen Interessen hinweg getäuscht. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Erbschaftsteuer: Populisten wie Markus Söder hetzen gegen die Erbschaftsteuer und behaupten, das Häuschen der Oma solle den Menschen wegbesteuert werden. Dass er selbst eine reiche Erbin geheiratet hat und ein eigennütziges Interesse daran hat, dass sehr reiche Menschen keine Erbschaftsteuer bezahlen müssen, verschweigt er uns.“
„Wir Menschen haben doch eine egoistische und eine prosoziale Seite. Wir sorgen für uns und wir sorgen für andere. So ist unser natürliches Set-up. Nun haben wir mit dem modernen Kapitalismus und insbesondere dem Finanzmarkt aber ein System gebaut, das ganz bewusst sagt: Reiner Egoismus ist die Norm.“
Reiche belasten die Umwelt unendlich viel mehr als Arme. Das gilt global genauso wie für Deutschland. Müsste klimaschädliches Verhalten, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im Konsum, sehr viel stärker bestraft werden? Mehr noch, können wir uns ein System noch leisten, das den Egoismus als Uhrwerk des Kapitalismus und Funktionsprinzip in den Mittelpunkt stellt? Brauchen wir einen neuen, ernst gemeinten moralischen Wertekanon?
„Absolut. Wir Menschen haben doch eine egoistische und eine prosoziale Seite. Wir sorgen für uns und wir sorgen für andere. So ist unser natürliches Set-up. Nun haben wir mit dem modernen Kapitalismus und insbesondere dem Finanzmarkt aber ein System gebaut, das ganz bewusst sagt: Reiner Egoismus ist die Norm. Wer in diesem System Erfolg haben will, muss quasi seine prosoziale Seite ausblenden. Dass dieses System dabei ist, unsere Lebensgrundlage zu zerstören, sollte eigentlich niemanden überraschen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten in einer Wohngemeinschaft mit fünf extremen Psychopathen leben, die immer nur versuchen, ihren Eigennutzen zu maximieren. Wo würde Sie das perspektivisch hinführen?“
Wie sähen Ihr idealer Staat, Ihre ideale Gesellschaft und Ihr Wertekanon aus?
„Ich will mir nicht anmaßen, eine komplette Vision für einen besseren Staat zu zeichnen. Aber ich denke, das zu tun, ist jetzt genau die Aufgabe, die für uns als Gesellschaft ansteht: Wir sind eine der reichsten Gesellschaften, die es jemals gab. Gerade sind wir auf einem Pfad, der sehr viel Wohlstand zerstören wird. Wie können wir auf einen Pfad kommen hin zu einer besseren Gesellschaft? Dazu wird auch gehören, dass wir Wohlstand neu definieren und natürlich auch dafür sorgen, dass möglichst alle Menschen im Land an diesem Wohlstand partizipieren können.“
Ist Bildung der Schlüssel?
„Bildung ist immer wichtig, natürlich sollten wir mehr Geld ausgeben, um dafür zu sorgen, dass alle Menschen im Land mit den gleichen Startchancen ins Erwachsenenleben starten. Das wird uns kurzfristig aber nicht helfen, erst mal müssen wir an Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit ran. Wenn viele Menschen Ersparnisse haben oder durch Bürgerinnengeld und Grunderbe am Wohlstand beteiligt werden, haben automatisch auch mehr Menschen Zugang zu sehr guter Bildung. Daher macht es mehr Sinn, erst mal dort anzusetzen.“
Letzte Frage: Wie halten Sie es mit dem Luther’schen Apfelbaum angesichts der globalen Krisen und des leider globalen Rechtsrucks, mit dem Wunsch nach dem „starken weißen Mann“, den viele inzwischen offen propagieren? Würden Sie besagten Baum pflanzen?
„Ich sehe es als unser aller Aufgabe, möglichst viel dazu beizutragen, dass auch künftige Generationen eine gute Lebensgrundlage haben. Ob man dafür im wörtlichen Sinn Bäume pflanzt oder seine Energie und sein Geld in Projekte steckt, die die Gesellschaft voranbringen, muss jeder für sich entscheiden.“
Der Gesprächspartner
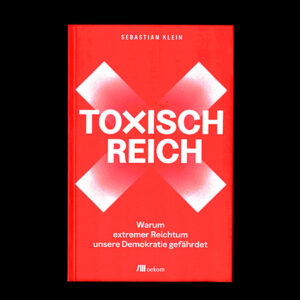
ISBN: 978-3-98726-138-1
Softcover, 208 Seiten



