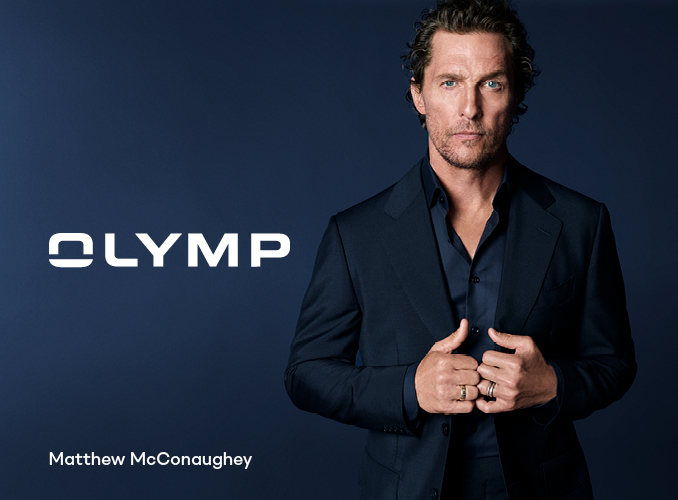Autorin: Eva WesthoffWie viel virtuelles Wasser verbirgt sich in europäischen Kleiderschränken? Der „Epson water footprint report“ macht es transparent – ebenso, dass das Bewusstsein für den hohen Einsatz dieser Ressource bei der Produktion von Textilien bislang nicht sonderlich ausgeprägt ist. Wie lässt sich gegensteuern? Prof. Dr. Maike Rabe, Leiterin des Forschungsinstituts für Textil und Bekleidung an der Hochschule Niederrhein, sieht in Digitaldrucktechnologie, wie sie Epsons Textildrucker Monna Lisa bereithält, durchaus Potenzial, den Wasserverbrauch bei der Textilveredlung zu senken und die Ökobilanz auch darüber hinaus zu verbessern.
Eine neue Studie, in Auftrag gegeben durch das Unternehmen Epson, berechnet und vergleicht den „Wasserfußabdruck“ des Inhalts von Kleiderschränken in acht europäischen Ländern. Dem „Epson water footprint report“ zufolge werden für die Herstellung aller Kleidungsstücke in einem durchschnittlichen deutschen Kleiderschrank insgesamt knapp 700.000 Liter Wasser benötigt – das entspricht etwa 4.640 Badewannenfüllungen. In der Studie rangiert Deutschland damit auf Platz vier.
Die Zahlen basieren auf einer vom Marktforschungsinstitut Censuswide im vergangenen Herbst durchgeführten Umfrage. Für die Studie befragt wurden insgesamt 8.007 Teilnehmende im Alter ab 16 Jahren in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal, Deutschland, Italien, Polen und den Niederlanden. Zum einen wurde ermittelt, wie viele Kleidungsstücke pro Kategorie ein durchschnittlicher Verbraucher im jeweiligen Markt besitzt. Hinzugezogen wurden außerdem Daten von GREENSTORY, einer speziell für die Modeindustrie entwickelten Intelligence-Plattform, die Einblicke in den ökologischen Fußabdruck eines Produkts bietet. Die in die Studie eingeflossenen Daten geben Aufschluss darüber, wie viele Liter Wasser ein Kleidungsstück durchschnittlich bei der Herstellung verbraucht.
18.000 Liter Wasser für eine Jeans
Für die Produktion, Veredelung und Färbung einer einzigen Jeans werden laut „Epson water footprint report“ durchschnittlich etwa 18.000 Liter Wasser benötigt. Besonders zu Buche schlägt dabei die Stoffproduktion. Doch auch der Färbeprozess wirkt sich nicht unerheblich auf den Gesamtverbrauch aus. So erfordert die Färbung einer Jacke laut Studie beispielsweise durchschnittlich etwa 3.300 Liter Wasser.
In der Umfrage zeigten sich 84 Prozent der Befragten angesichts der Wassermengen überrascht, 53 Prozent war der Begriff „water footprint“ zuvor nicht geläufig. Dies verdeutlicht das geringe Bewusstsein für den hohen Einsatz dieser Ressource bei der Produktion von Textilien. 77 Prozent der deutschen Befragten gaben an, sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, gut zwei Drittel (67 Prozent) hatten keine Vorstellung, wie viel Wasser zum Färben ihrer Kleidung benötigt wird.
„Die Erkenntnisse aus dem ‚Epson water footprint report‘ überraschen selbst Brancheninsider wie mich.“ Carl Tillessen, Geschäftsführer DMI
„Am 24. Juli werden wir den Erdüberlastungstag (Earth Overshoot Day) erreichen, das heißt den Tag, ab dem unser jährlicher Verbrauch an natürlichen Ressourcen die Kapazität der Erde zur Reproduktion dieser Ressourcen übersteigt“, erinnert Carl Tillessen, Geschäftsführer des Deutschen Mode-Instituts (DMI). „Wasser ist eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste dieser natürlichen Ressourcen. Insofern müssen wir uns auch die Frage stellen, welchen Anteil eigentlich unsere Kleidung am Verbrauch dieser Ressource hat und wie man diesen reduzieren kann. Die wertvollen Erkenntnisse hierzu, die der ‚Epson water footprint report‘ ans Licht gebracht hat, überraschen selbst gut informierte Brancheninsider wie mich.“
Die Studie zeige dabei nicht nur auf, dass es „allein für die Herstellung eines Paar Socken beinahe 1.000 Liter Wasser braucht“, so Tillessen. Deutlich werde auch das mangelnde Bewusstsein für das Thema. „Wenn es um mehr Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Kleidung geht, dreht es sich eben meist um dieselben Aspekte – etwa Bio-Baumwolle und Kunstfasern aus PET-Flaschen oder Fischernetzen –, während andere Aspekte wie zum Beispiel der Wasserverbrauch kaum Thema werden.“ Nebenbei gesagt, sei allein schon spannend, was die Studie über die Zusammensetzung europäischer Kleiderschränke zutage fördere: „Deutschland ist T-Shirt-, Jacken- und Socken-Europameister.“
Offiziellen Schätzungen zufolge ist die Textilindustrie weltweit für rund 20 Prozent des industriellen Abwassers verantwortlich. Von den Befragten des „Epson water footprint report“ zeigten sich immerhin 53 Prozent besorgt über die Umweltauswirkungen der Modeindustrie. Wie lässt sich der Wasserverbrauch senken? Um eine Möglichkeit aufzuzeigen, hat Epson begleitend zur Studie in Zusammenarbeit mit dem Londoner Studio PATTERNITY die Kollektion „Water Silks“ entworfen. Dabei handelt es sich um eine Serie bedruckter Schals, die zu 65 Prozent aus EcoVero™ und zu 35 Prozent aus Seide bestehen. Bedruckt wurden sie mithilfe des industriellen Textildruckers Monna Lisa von Epson. Im Vergleich zu traditionellen Prozessen könne der Wasserverbrauch beim Farbdruck um bis zu 97 Prozent reduziert werden, heißt es seitens des Unternehmens. Innovative digitale Textildrucktechnologien böten somit eine ressourcenschonendere Alternative und ermöglichten es zudem, neuartige Textilien zu bedrucken.
Mit dem digitalen Textildruck in eine nachhaltigere Zukunft?
Prof. Dr. Maike Rabe, Leiterin des Forschungsinstituts für Textil und Bekleidung an der Hochschule Niederrhein und Expertin für Textilveredlung und Ökologie, bekräftigt, dass Epsons „water footprint report“ mit dem Verbrauch von Ressourcen bei der Herstellung und Veredlung von Textilien ein sehr wichtiges Thema adressiert. Zu ihrer Einschätzung des Potenzials der digitalen Textildrucktechnologie befragt, bestätigt Prof. Rabe eine deutliche Reduktion des Wasserverbrauchs gegenüber konventionellem Druck und Färberei. In Zahlen könne sie es nicht fassen, da jede Ökobilanz ihre eigenen Grenzen aufweise. Prof. Rabe merkt zudem kritisch an, dass bei der Bilanzierung verschiedene Substrate betrachtet wurden, der Vergleich zwischen Seidenschals und Schals, die zu 65 Prozent aus EcoVero™, einer Cellulose-Regeneratfaser, bestehen, hinke. Zu beachten sei zudem, dass der größte Wasserbedarf in der Fasererzeugung, der Vorbehandlung (zum Beispiel der Rohwarenwäsche vor dem Druck) und später beim Verbraucher anfalle.
In der digitalen Textildrucktechnologie sieht Prof. Rabe weitere Vorteile:
- „Der digitale Druck, den Epson hier beschreibt, bietet die Möglichkeit, Textilien on demand zu gestalten und auf diese Weise Überproduktion zu vermeiden. Sehr gut.“
- „Der Digitaldruck kommt mit geringen Tintenmengen aus, deutlich niedriger als der konventionelle Schablonendruck und noch um ein Vielfaches weniger als die Färberei. Sehr gut.“
- „Das verwendete Tintensystem basiert auf Pigmenttinten. Diese benötigen keine energieintensive Fixierung zum Beispiel in Dampf, sondern nur eine Hitzefixierung, die Fertigstellung durch Nachwäsche und erneutes Trocknen entfällt. Sehr gut.“
Die verwendeten Pigmenttinten hätten jedoch den Nachteil, dass sie nur oberflächlich anhaften und über Bindemittel fixiert würden. Die Fasern würden nicht kerntief farblich gestaltet. Die Haltbarkeit dieser Drucke sei nicht ganz so gut einzuschätzen wie zum Beispiel bei Reaktiv- oder Säurefarbstoffen. „Der digitale Druck ist nur oberflächlich und kann dadurch nicht die Qualität einer Färbung oder eines Schablonendrucks ersetzen. In sehr vielen Fällen ist diese Oberflächengestaltung aber ausreichend und damit überzeugt dieses Verfahren auf jeden Fall in Bezug auf Ressourceneffizienz.“
Mit dem Verdrucken von Pigmenten in digitalen Systemen sei technologisch ein großer Fortschritt erzielt worden, resümiert Prof. Dr. Maike Rabe. „Der Pigmentdruck ist sehr flexibel in Bezug auf die Substrate und kommt mit weniger Prozessschritten aus. Weiterhin ist der Digitaldruck dem Schablonendruck in Bezug auf Nachhaltigkeit überlegen. Lange ließen sich diese Methoden aber nicht kombinieren, das heißt, der Pigmentdruck konnte nicht digital realisiert werden, da Bindemittel und Pigmente zu einem Verblocken der Düsensysteme führten. Dies ist nun seit einiger Zeit möglich und auch die Firma Epson bietet mit Monna Lisa ein reifes Produkt an.“