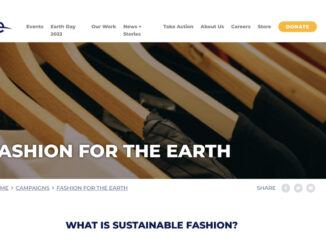Autor: Markus Oess
Das Musikmagazin Rolling Stone adelt die Drei-Tages-Sause in dem kleinen Beverungen als das „beste kleine Open-Air-Festival der Welt“. Die Karten für die 3.000 Besucher sind ratzfatz ausverkauft. Sicher könnten die Macher des Orange Blossom Specials (OBS) mehr Geld machen und umziehen. Aber: „Wir bleiben in unserem Garten“, sagt der Mann, der für das Line-up verantwortlich ist. Rembert Stiewe im FT-Interview über Musik und Mode, ihren Spirit und ihre Sünden.

©WDR/Annika Fußwinkel
FT: Orange Blossom entstand aus der Idee einer Grillparty mit Live-Musik für die Kunden des angeschlossenen Mailorder-Vertriebs von Glitterhouse. Ein Plattenlabel, das ihr 1981 gegründet habt. Wie kam das?
Rembert Stiewe: „Damals haben wir auf Glitterhouse Records hauptsächlich US-amerikanische Bands veröffentlicht. Wenn die Bands in Europa auf Tour waren, schauten sie zwischen den Konzerten gerne bei uns vorbei. Im Sommer 1996 war das zum Beispiel mit den Go to Blazes der Fall, einer Band aus Philadelphia. Im Garten hinter dem Firmengebäude, einer alten, runtergekommenen Gründerzeitvilla, haben wir ein paar Steaks auf den Grill gelegt und ein paar Biere geöffnet. Die Band holte dann irgendwann ihre akustischen Instrumente aus dem Tourbus und spielte ein paar Stunden. Wir schauten uns an und sagten: ‚Lass uns das öfter machen.‘
Im Jahr drauf dann haben wir in unserem Garten ein kleines, feines Festival mit fünf Bands veranstaltet. Der Eintritt war frei und es kamen rund 600 Leute, was uns wirklich überrascht hat. Das war alles noch sehr unprofessionell organisiert, hatte aber großen Charme. Weil es den Besuchern und uns solch riesigen Spaß gemacht hat, haben wir das dann einfach im jährlichen Rhythmus fortgesetzt. Irgendwann schaute dann auch der WDR-Rockpalast vorbei, huch, da waren wir im Fernsehen, es gab Medienecho, in der Musikpresse und im Radio wurde das OBS als besonderes Entdeckerfestival gefeiert. Ein hier auftretender Musiker beschrieb es mal ganz treffend: ‚Man merkt dem Festival an, dass es aus den richtigen Gründen entstanden ist. Nicht aus kommerzieller Gier, sondern aus Liebe zur Musik und Spaß an der Sache. Es hat den Spirit.‘ Das trifft es. Wir könnten natürlich mit dem OBS umziehen und deutlich mehr Karten verkaufen. Nur wäre es dann nicht mehr unser OBS. Wir bleiben in unserem Garten. Da passen 3.000 Leute rein und mittlerweile treten hier jährlich 26 Bands auf. Hat sich also entwickelt.“
Wer sucht die Musiker aus?
„Das mache ich. Auswahl und Planung sind eine One-Man-Show, aber wir arbeiten, je näher die Veranstaltung kommt, in einem fantastischen Team. Anders wäre das OBS nicht zu stemmen. Inzwischen habe ich auch ein enges Netzwerk aus Freunden und professionellen Tour-Agenturen, auf deren Empfehlungen ich mich oft verlassen kann. Zudem kannst du heute im Netz zig Bands live anschauen, ohne ins Auto oder den Flieger steigen zu müssen. Ich besuche verschiedene Showcase-Festivals und bin generell gerne auf Konzerten.
Allerdings kann ich kaum noch eine mir zuvor unbekannte Band im Konzert unvoreingenommen genießen – ich frage mich immer sofort, ob die Band zum OBS passen würde oder nicht. Wenn ich das bejahe, stelle ich spätestens beim dritten Lied die Überlegung an, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit der Auftritt laufen sollte. Da ist schon ein bisschen Besessenheit dabei.
Ich lasse mich dann von meinem Bauchgefühl leiten, in das Booking fließen viel eigener Geschmack, missionarischer Eifer und Entdeckergeist.
Ich möchte allen Besuchern wenigstens zwei, drei Bands präsentieren, von denen sie vorher nichts wussten und die sie einfach gut finden. Es ist immer ein super Gefühl, wenn eine Band auf dem Festival einschlägt, fast als stünde ich selbst mit der Gitarre da oben. Ich bin kein Musiker, meine kreative Leistung ist stattdessen das Zusammenstellen des Programms.“
Schon mal danebengegriffen?
„Natürlich ist das eine oder andere Konzert vielleicht nicht so sensationell gewesen wie andere, aber einen richtigen Fehlgriff gab es nicht. Mein Netzwerk, meine Qualitäten als Trüffelschwein und mein Bauchgefühl harmonieren offensichtlich ganz gut.“
Diesmal ziert ein Graureiher die Festivalplakate, letztes Mal war es ein Einhorn. Warum sind immer Tiere das Key Visual?
„Sind sie gar nicht. Zumindest nicht von Beginn an. Anfangs hatten wir optisch – der Festivalname hat es gefordert – mehr auf kalifornische Orange Crate Art aus den 1920er- bis 1950er-Jahren gemacht. Wir fanden den Stil einfach cool.
Mit der musikalischen Öffnung ab der zehnten Ausgabe in Richtung deutscher Indie-Rock, skandinavische Melancholie oder Post-Punk änderten wir auch die optische Anmutung. Plötzlich landete ein Hirsch auf dem Plakat. Danach kamen wie von selbst verschiedene andere Tiere, mal eher niedlich, mal eher abstrakt – und dabei ist es bisher geblieben. Ich will die Logos aber gar nicht mit zu viel Bedeutung aufladen – es ist nicht so tiefgründig, wie vielleicht vermutet.
Wir wechseln das Bildmotiv jedes Jahr, behalten aber die Wortmarke unverändert bei. Ist übrigens gar nicht so schlecht fürs Merchandising.“
Die 1980er waren modisch nicht immer ganz treffsicher, wie würdest du deinen damaligen Kleidungsstil bezeichnen?
„Im Nachhinein gab es da natürlich furchtbare Kleidungssünden, aber so waren die Zeiten eben. Irgendwann hangelten sich meine modischen an den musikalischen Vorlieben entlang. In den Anfängen des Labels haben wir 1960er-Revival-Garagenrock gehört und veröffentlicht. Da waren Chelsea Boots, Paisley-Hemden und Fransenlederjacke angesagt. In den späten Achtzigern kam Grunge auf. Stilecht trug ich löchrige Jeans, ein langärmliges Unterhemd und zog ein großkariertes Holzfällerhemd darüber. Wie die Hälfte der an Jugendkultur und Rockmusik interessierten Weltbevölkerung damals. Ich hatte auch mal einen echten gekrempelten Cowboy-Hut, so was würde ich heute auf gar keinen Fall mehr aufsetzen, das ist stilistisch so furchtbar drüber.
Irgendwann mit dem Alter wird man ja selbstzufriedener und bescheidener mit dem Aussehen. Heute sieht mein Kleiderschrank ziemlich dunkel aus: Jeans, bevorzugt Dickies oder Ben Sherman und schwarze Pilotenhemden. Schwarze Band-Shirts oder Hoodies bringt der Job ganz automatisch mit sich. Dazu als Gipfel an modischen Statements Chucks oder Vans und meine Ray Ban. Eher unauffällig also und nicht besonders fancy. Meine Lieblingsfarben sind eben Schwarz und fröhliches Anthrazit und der Stil sollte auch mit den Körperformen und dem Wesen harmonieren.“
Dann kam 1997 das erste OBS. Hattest du dir ein Bühnenoutfit überlegt oder spontan zu den Klamotten gegriffen?
„Nee, Bühnenoutfit passt nicht zum OBS. Wenn es nicht zu einer inszenierten Situation gehört, jedenfalls. Alles andere käme mir künstlich und prätentiös vor. Ich nehme das, was gerade gewaschen im Schrank hängt. Sieht eh alles gleich aus.“
Inzwischen schenkt der ortsansässige Supermarkt den Festivalbesuchern beim Einkauf ein Bier, ziehen Händlerschaft und Gastronomie mit. Kaum vorstellbar, dass das 1997 auch schon so war. Was war denn in den Anfängen in Beverungen modisch angesagt?
„Das war wie überall woanders auch, im Nachhinein teils wirklich gruseliger Kram. Reste der 1980er, die es irgendwie noch bis ’97 geschafft haben. Karottenhosen und bunte Blazer. Stonewashed Jeans. Ganz groß: Minipli oder Vokuhila und Schnauzbart. Na ja, ganz so schlimm war es vielleicht nicht. Die Rückschau verklärt da einiges und lässt auch die Mode-Dekaden verschwimmen.“
Wo habt ihr euch kleidungstechnisch eingedeckt?
„Ich habe mich gerne in Secondhandläden eingedeckt, in Göttingen und Kassel. Dort gab es mal das eine oder andere ausgefallene Schnäppchen oder LEVI’S 501 zu bezahlbaren Preisen, auch wenn die eine schreckliche Passform hatte, die machte meine kurzen, dicken Fußballerbeine nicht attraktiver. Den Geruch dieser Läden habe ich heute noch in der Nase. Prunkstück meines Kleiderschranks war eine alte, abgeschabte grüne Polizei-Lederjacke.“
Wie sieht es heute aus?
„Ich bin Fan und Unterstützer des lokalen Einzelhandels. Leider geht das in Beverungen nur für die Basics. Ich kaufe auch im Internet und hier und da auch auf Reisen. Mode ist aber wirklich nicht meine Kernkompetenz oder gar Lebensinhalt. Ich bin damit zufrieden, mir selbst treu zu sein. Inzwischen achte ich auch darauf, wo die Sachen herkommen und unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden.“
Fehlen dir Tattoos, Piercings und sonstige Erkennungsmuster, die für das Musikgeschäft stehen? Ist es dann Absicht und du mähst sonst jeden Samstag den heimischen Rasen und anschließend wird zur Belohnung mit den Nachbarn gegrillt?
„Tattoos habe ich einige. Ich habe mir gerade auch unser aktuelles OBS-Motiv, den Graureiher, stechen lassen. Aber ich lasse mich nur tätowieren, wenn ich das Motiv so geil finde, dass ich es ein Leben lang tragen will, nicht aus dem Wunsch heraus, zu einer Szene dazuzugehören. Aus dem Alter, cool sein zu müssen beziehungsweise Coolness über meine Kleidung ausstrahlen zu müssen, bin ich wirklich raus.
Ohrringe habe ich, Piercings nicht. Den Rasen mähe ich zu Hause übrigens trotzdem, Grillparty inklusive. Habe gehört, dass manchmal daraus Großes entsteht.“
Trägst du auch mal einen kompletten Business-Anzug und wenn ja, mehr klassisch, modisch elegant oder gar britisch?
„Bei Geschäftsterminen kommt das schon vor. Ich bevorzuge den klassischen Normalo, auch hier wieder in fröhlichem Anthrazit. Für mich ist das aber Arbeitskleidung wie der Blaumann in der Fabrik. Ist nicht mein Lieblingsteil.“
Mode und Musik gehören eng zusammen. Ob richtig kommerziell, politisch engagiert oder altromantisch in alten Zeiten schwelgend – jede Stilrichtung hat ihre ‚Uniformen‘. Warum ist das so wichtig?
„Jede Jugendbewegung hat ihre Rituale, ihre Musik und ihre Kleidung, ihren Stil. Da geht es oft um Abgrenzung und Distinktionsgewinn. Die Menschen fühlen sich diesem Lebensgefühl zugehörig und zeigen dies auch äußerlich über einen bestimmten Code. Jeder Code hat etwas mit gefühltem Nonkonformismus zu tun, da er sich abhebt von anderen Codes. Schön siehst du das beim Punk. Da herrscht Anarchie und da darfst du alles machen. Sei möglichst abgerotzt und lass es dir schlecht gehen. Alles gut, aber nur theoretisch. Denn richtig spannend wird es, wenn jemand die Traute hat, innerhalb dieser Peer Group steil zu gehen und dann meinetwegen Anzug zu tragen. Also im wahrsten Sinne nonkonformistisch. Der oder diejenige wird sich keine Freunde dort machen, da wird schnell ausgegrenzt.
Aber jede soziale Gruppe hat ihre Klamotten, ihre Erkennungsmerkmale. Man könnte das natürlich auch Uniformierung nennen. Aber ich bevorzuge den Begriff Bekenntnis.“
Beim OBS scheinen irgendwie die Grenzen zu verwischen, sind Junge und Alte friedlich vereint. Hat sich das Publikum mit der Zeit verändert oder kommt heute gleich die ganze Familie?
„Beides. Wir haben uns musikalisch geöffnet und damit wurde das Publikum jünger. Trotzdem haben wir unser Gen nicht aufgegeben. Also kommen auch noch die ‚Alten‘. Viele sind mit uns in Ehren ergraut und bringen ihren Nachwuchs mit. Hin und wieder ist es auch umgekehrt. Wir bringen Musiker auf das Festival, das in Summe ein breites Publikum anspricht, das eines vereint: Interesse an Live-Musik jenseits des Mainstreams und sich in besonderer Atmosphäre vom alltäglichen Einerlei abzukoppeln. Allerdings holen wir nicht Bands auf die Bühne, die möglichst allen gefallen, sondern haben ein Line-up, bei dem für jeden Einzelnen was Besonderes dabei ist. Also kein Einheitsbrei, sondern ein Buffet mit vielen Delikatessen.“

Auch beim OBS verkaufen Händler Bekleidung, nach welchen Kriterien sucht ihr die Anbieter aus?
„Sie dürfen nicht viel Platz belegen. Ernsthaft, wir haben weder die räumlichen Kapazitäten noch die Absicht, das OBS zu einer Shoppingparty verkommen zu lassen. Das können andere kommerzielle Festivals sowieso besser.
Wer bei uns verkauft, muss zu uns und unseren Idealen passen: fair, nachhaltig und kein Kommerz. [eyd] beispielsweise (Wir haben das Label im Rahmen der Berlin-Berichterstattung im Sommer vorgestellt, die Red.) holt Frauen in Indien aus der Zwangsprostitution und gibt ihnen ihr Leben zurück. Sie bekommen eine Ausbildung zur Näherin, es wird ihnen mit Respekt begegnet, sie erfahren teils erstmals, dass sie etwas wert sind, dass sie und ihre Arbeit geschätzt werden. Da hat es bei mir gleich gefunkt. Wir haben schon mit dem Vorgängerlabel zusammengearbeitet. Ich will das Projekt noch weiter unterstützen und deswegen haben wir zu unseren sowieso schon zertifizierten Festival-Shirts für 18 Euro auch gemeinsam mit [eyd] eine kleine Premium-Linie aufgelegt, die für 35 Euro den Besitzer wechselt. Die humanitär produzierte und vertriebene Mode geht noch einen Schritt weiter als faire Mode. Man muss das anfangs vielleicht ein bisschen erklären, dass der Preis kein Wucher ist, sondern dass es eben einen Unterschied fürs Karma-Konto macht, ob ich PRIMARK-Ramsch kaufe, der unter katastrophalen Bedingungen produziert wird, oder humanitäre Mode. Das ist eine soziale Verantwortung. Das OBS-Publikum ist solchen Initiativen gegenüber aber sehr offen und unterstützend eingestellt.“
Ihr kooperiert diesmal neben Viva con Agua und [eyd] auch mit Sea-Watch. Wie sieht das genau aus?
„Wir sammeln bereits seit zehn Jahren für Viva con Agua. Seit vier Jahren ist die Organisation selbst mit eigenen Leuten vor Ort, nachdem sich hier in der Region eine lokale Unterstützergruppe gebildet hat. Das ,Gebt uns euer Becherpfand‘ kennt man ja von vielen Festivals. Hinzu kommen bei uns dann noch die Versteigerung eines von allen auftretenden Musikern signierten Bildes und der Verkauf von Secondhand-Bandshirts und selbst bemalten Festival-Stoffbeuteln und -rucksäcken für Viva con Agua. Auch die Besucher, die über Gästeliste gratis hereinkommen, werden gebeten zu spenden.
Was Sea-Watch betrifft: Ich kann die Leute von Sea-Watch nur bewundern. Das ist wirklich groß, was die machen. Schließlich riskieren sie freiwillig viel, um Flüchtende im Mittelmeer aus dem Wasser zu ziehen und in einen sicheren Hafen zu bringen. Flucht ist kein Verbrechen und die menschliche Tragödie, die dort passiert, bekommt man ja nur am Rande durch Fernsehbilder mit. Dass mit Billigung der EU, mit Billigung von uns allen also, im Mittelmeer zahllose Flüchtende sterben oder mit Unterstützung der europäischen Regierungen die Flüchtenden von der libyschen Küstenwache zurück in Lager verbracht werden, wo erwiesenermaßen Folter und Zwangsarbeit auf sie warten, das ist schlicht ein Skandal.
Viele Menschen stumpfen vor den Bildschirmen ab. Andere bagatellisieren das Flüchtlingsdrama oder erklären es zum Todesstoß für die Republik, je nach Absicht, die damit verfolgt wird.
Eine OBS-Festival-Besucherin arbeitet für Sea-Watch. Sie ist Mitglied einer der Crews, die ehrenamtlich sozusagen an der humanitären Front kämpft, die das Leben von Ertrinkenden rettet. Sie wird beim OBS in einer Präsentation vortragen, wie es wirklich auf dem Mittelmeer aussieht, mit welchen Problemen die Leute zu kämpfen haben und welche politischen Gremien tausendfachen Tod billigend in Kauf nehmen.
Um selbst aufs Schiff zu gehen, habe ich zu viel Bammel. Ich habe mir überlegt, was ich tun kann, um zu helfen. Wo ich das, was ich kann, einbringen kann.
Jetzt verarbeiten wir das Sea-Watch-Logo in unserem Merchandising, vor allem auf unseren T-Shirts. So werden die Leute jedes Mal, wenn sie es tragen, wieder aufs Neue mit dem Thema konfrontiert. Wir wollen das Bewusstsein dafür schärfen zu helfen. Außerdem werden wir einen Teil der Erlöse aus dem Merchandising an Sea-Watch spenden. Und dazu passt unser diesjähriges Motto so gut: ‚Hope & Anchor‘.“
„Ich bin ein Idealist und was das OBS angeht, durchaus ein bisschen missionarisch unterwegs, aber ich bin auch Pragmatiker. Wenn wir hier lediglich die humanitäre Insel des Guten aufbauen würden, ohne auch auf kaufmännische Prinzipien zu achten, hätte mittelfristig niemand etwas davon, da das Festival dann nicht überleben könnte. Das muss also in Waage gebracht werden.
Was bei uns gar nicht geht, sind Branchen, die einfach nicht zum Geist des OBS passen. Autokonzerne zum Beispiel. Auch passen nicht alle Firmen und Produkte zu uns. Red Bull etwa ginge gar nicht. Die würden uns zwar – wenn sie das denn wollten, das OBS passt sicher nicht in ihre Marketingstrategie – mit Geld zuschütten, aber dann sähe alles nach Red Bull aus. Die Marke stülpt ihren eigenen Markenkern allen anderen über.
Mit Marken zu kooperieren, die einen Bezug zum OBS haben oder bei denen ich mir sicher bin, dass es die Erlebenswelt der OBS-Besucher nicht stört, ist dagegen völlig okay, finde ich. Auf Festivals wird Bier getrunken, warum dann nicht von der bei uns angebotenen Biermarke sponsern lassen? Oder von einem örtlichen Versandhandel für Camping- und Angelbedarf? Oder vom örtlichen Lebensmittelhändler? Das ist alles völlig okay.
Kommerz geht daher bei uns nur so weit, bis er die Seele des OBS berührt: gute Musik für gute Leute in guter Atmosphäre. Ohne dass die Örtlichkeit und die Stimmung unter marktschreierischem Brimborium leiden.“
Was würdest du antworten, wenn plötzlich LEVI’S anklopft, die machen ja auch viel mit Festivals?
„Wir hatten schon mal Lee als Sponsor und auch Jack Wolfskin. Bei Lee gingen die Leute auf Kontra mit dem Argument, dass die Jeansproduktion saumäßig viel Wasser verbraucht und die Herstellung oft unter katastrophalen Bedingungen für Mensch und Natur durchgedrückt wird. Kann ich im Nachhinein auch ein bisschen verstehen, damals waren meine Sinne diesbezüglich vielleicht noch nicht so geschärft. Andererseits glaube ich kaum, dass all jene, die sich damals aufregten, in fair und humanitär produzierten Jeans herumlaufen. Im Netz verbreitete Meinungen schaukeln sich ja bekanntlich schnell zu hysterischen Ausmaßen auf.
Bei Jack Wolfskin wiederum hat niemand was gesagt, weil wahrscheinlich jeder Dritte im Publikum so ein Teil im Schrank hängen hat.
Um auf LEVI’S zurückzukommen: Ich würde mich erst mal schlaumachen, mir ansehen, was LEVI’S heute so treibt – und danach entscheiden. Vielleicht würde mich das ja zufriedenstellen und gut möglich, dass ich dann Geld hätte, um eine weitere Top-Band einzuladen. Aber genauso wäre es möglich, dass ich ihnen absagen würde oder dass sie noch ein, zwei Jahre warten müssten mit ihrem Auftritt in unserem Garten. Mit solch einem Sponsor wäre es ein bisschen wie bei manchen Bands, die sich hier bewerben: Arbeitet an euch und dann sehen wir irgendwann mal, ob es passt. Da bin ich ziemlich stur.
Es ist aber auch nicht so, dass hier am Sponsoring des OBS interessierte Unternehmen Schlange stehen würden. Ich muss daher auch so gut wie niemanden abwimmeln.“
Glitterhouse-Garten
Das dreitägige Musikfestival Orange Blossom Special (OBS) läuft seit 1997 an Pfingsten im ostwestfälischen Beverungen. Veranstalter ist das Musiklabel Glitterhouse Records. Der Name des Festivals ist eine Verneigung vor Johnny Cashs gleichnamigem Song Orange Blossom Special. Das OBS entstand aus einer Grillparty mit Live-Musik. Die Besucherzahl beschränken die Macher bewusst auf die Kapazität des Gartens hinter der Gründerzeitvilla, in der Glitterhouse seinen Firmensitz hat. Moderiert wird die Veranstaltung von den Glitterhouse-Chefs Rembert Stiewe und Reinhard Holstein. An den drei Tagen treten um die 25 nationale und internationale Bands auf, hauptsächlich Indie-Rock, Singer-Songwriter, Rock, Folk und World.
Ernte 23
Der Mann lebt immer noch in seinem Geburtsort Beverungen. Die Ausbildung von Rembert Stiewe im Schnelldurchlauf: Abitur, Zivildienst, Magister-Studium in Göttingen (Sportwissenschaften, Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft), Studienabbruch. Diverse Nebenjobs von Straßenbau bis Tennislehrer. 1984 ist Rembert Mitbegründer von Glitterhouse Records, einem Indie-Label, das 2015 als „Best Label“ bei den VIA! VUT Indie Awards ausgezeichnet wurde. Er veranstaltet seit 1997 das Open-Air-Festival Orange Blossom Special (OBS), das jährlich zu Pfingsten internationale Bands und knapp 3.000 Menschen im Garten der Firma Glitterhouse versammelt. Daneben arbeitet er als Geschäftsführer des Beverunger Stadtmarketings und freiberuflich als Journalist. Unter anderem moderiert er die Fernsehreihe „Rockpalast: Crossroads“ (WDR und 3sat) und diverse Panels im Rahmen der Reeperbahn-Festival-Konferenz. Rembert ist 54 Jahre alt, verheiratet. Der Vater eines 34-jährigen Sohnes und Großvater eines ein Jahr alten Enkels trinkt gerne Bier, billigen Bourbon und Ouzo und raucht Ernte 23.